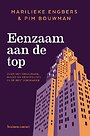1. Elektronische Märkte — Formen und Aspekte.- 1.1. Technologie und Marktwandel.- 1.2. Basistechnologien.- 1.2.1. Electronic Data Interchange.- 1.2.2. Internet.- 1.2.3. Verschlüsselung und Signatur.- 1.2.4. Elektronische Zahlungssysteme.- 1.2.5. Intelligente Agenten.- 1.3. Elektronische Markttransaktionen.- 1.3.1. Erfassung des Transaktionsbedürfnisses.- 1.3.2. Anbahnung und Verhandlung.- 1.3.2.1. Kataloge und Verzeichnisse.- 1.3.2.2. Suchmaschinen und Shopbots.- 1.3.2.3. Auktionen und Ausschreibungen.- 1.3.3. Vertragsschluss.- 1.3.4. Abwicklung.- 1.4. Anwendungsgebiete.- 1.4.1. Business to Business.- 1.4.1.1. Beschaffung und Absatz.- 1.4.1.2. Finanzmärkte.- 1.4.2. Business to Consumer.- 1.4.3. Consumer to Consumer.- 1.4.4. Andere Allokationsprobleme.- 1.4.4.1. Innerbetriebliche Ressourcenallokation.- 1.4.4.2. Technische Ressourcenallokation.- 1.5. Zusammenfassung und Fragestellung.- 2. Theoretische Grundlagen.- 2.1. Motivation des Gütertausches.- 2.2. Definition und Abgrenzung des Basismodells.- 2.2.1. Modellelemente.- 2.2.1.1. Topologie und Verhandlungsform.- 2.2.1.2. Kontraktraum.- 2.2.1.3. Transaktionsbedürfnis.- 2.2.1.4. Transaktionsform und Gewinn.- 2.2.2. Marktprozess.- 2.2.2.1. Transaktionspartnerwahl.- 2.2.2.2. Kontraktoptimierung.- 2.2.2.3. Gewinnverteilung und Preisbildung.- 2.2.3. Zusammenfassung und Erweiterungsansätze.- 2.2.3.1. Genealogie der Strukturmerkmale.- 2.2.3.2. Komplexere Transaktionswünsche.- 2.2.3.3. Multilaterale Transaktionen.- 2.3. Spieltheoretische Instrumente.- 2.3.1. Rationale Akteure.- 2.3.1.1. Präferenzordnung und Nutzenfunktion 5.- 2.3.1.2. Erwartungsnutzen.- 2.3.1.3. Risikopräferenz.- 2.3.2. Strategische Interaktion.- 2.3.2.1. Dominante Strategien.- 2.3.2.2. Nash-Gleichgewicht.- 2.3.2.3. Teilspielperfektheit.- 2.3.2.4. Wiederholte Spiele.- 2.3.2.5. Unvollständige Information.- 2.3.3. Mechanismusdesign.- 2.3.3.1. Problemdefinition.- 2.3.3.2. Entwurfsmethoden.- 2.3.3.3. Bewertungskriterien.- 3. Auktionen und Börsenmechanismen.- 3.1. Einfache Auktionen.- 3.1.1. Grundlagen.- 3.1.1.1. Auktionsablauf.- 3.1.1.2. Modellvarianten.- 3.1.2. Klassische Auktionsformen.- 3.1.2.1. Englische Auktion.- 3.1.2.2. Vickrey-Auktion.- 3.1.2.3. Holländische Auktion.- 3.1.2.4. Verdeckte Erstpreisauktion.- 3.1.3. Optimale Auktionen und Revenue-Equivalence.- 3.1.4. Kollusion in Auktionen.- 3.1.4.1. Bieterkartell.- 3.1.4.2. Informationshandel.- 3.1.4.3. Phantom-Gebote.- 3.2. Erweiterungsansätze.- 3.2.1. Mehrfache Transaktionen.- 3.2.1.1. Simultane Auktionen.- 3.2.1.2. Wiederholte Auktionen.- 3.2.2. Differenzierte Kontrakte.- 3.2.2.1. Multidimensional Auktionen.- 3.2.2.2. Kombinatorische Auktionen.- 3.2.3. Polypolistische Verhandlungen.- 3.2.3.1. Einmalige doppelte Auktionen.- 3.2.3.2. Wiederholte und kontinuierliche Varianten.- 3.3. Allgemeines kpi-Auktionsmodell.- 3.3.1. Grundmodell.- 3.3.1.1. Kontraktdifferenzierte Offerten.- 3.3.1.2. Auktionsablauf.- 3.3.2. Transaktionspartnerwahl und Kontraktoptimierung.- 3.3.2.1. Gesamtoptimum.- 3.3.2.2. Iterative Näherungslösung.- 3.3.2.3. Dynamisierte Iteration.- 3.3.2.4. Vergleichende Bewertung.- 3.3.2.4.1. Äquivalenzen.- 3.3.2.4.2. Effizienzaspekte.- 3.3.2.4.3. Zusammenfassung.- 3.3.3. Preisbildung.- 3.3.3.1. Erstpreise und Durchschnittspreise.- 3.3.3.2. Hinreichende Preise.- 3.3.3.3. Gleichgewichtspreise.- 3.3.3.4. Vergleichende Bewertung.- 4. Automatisierte Verhandlungen.- 4.1. Polypolistisches Automatisierungskonzept.- 4.1.1. Konzeptueller Ausgangspunkt.- 4.1.1.1. Spieltheoretischer Ansatz.- 4.1.1.2. Einordnung in die konventionellen MAS.- 4.1.2. Erwartungsbildung.- 4.1.2.1. Umweltmodell.- 4.1.2.2. Endogene Erwartungen.- 4.1.2.3. Informationsmodelle.- 4.1.2.3.1. Homogene Kontrakte.- 4.1.2.3.2. Dynamisierte Iteration.- 4.1.2.3.3. Diskussion.- 4.1.2.4. Aggregation und Extrapolation.- 4.1.3. Strategie.- 4.1.3.1. Einperiodiges Kalkül.- 4.1.3.2. Mehrperiodiges Kalkül.- 4.1.3.3. Strategisches Verhalten.- 4.1.3.3.1. Dynamische Aspekte.- 4.1.3.3.2. Strukturverzerrung.- 4.1.4. Weiterführende Fragestellungen.- 4.2. Aspekte anderer Akteurtypen.- 4.2.1. Monopolist.- 4.2.1.1. Klassisches Monopolmodell.- 4.2.1.2. Auktionsbasierter Monopolmarkt.- 4.2.1.2.1. Preis- und Mengenstrategie.- 4.2.1.2.2. Unsichere Erwartungen.- 4.2.1.2.3. Differenzierte Kontrakte.- 4.2.1.3. Diskussion.- 4.2.2. Dyopolist und Oligopolist.- 4.2.2.1. Wettbewerbsszenarien.- 4.2.2.2. Kooperation und Kartelllösung.- 4.2.2.3. Diskussion.- 5. Implementierung des Formalmodells.- 5.1. Architektur.- 5.1.1. Interaktionsmodell.- 5.1.1.1. Verhandlungsprotokoll.- 5.1.1.2. Fachliche Basistypen.- 5.1.1.3. Synchronisationskonzepte.- 5.1.2. Marktplatz.- 5.1.2.1. Marktzustand.- 5.1.2.2. Transaktionsbildung.- 5.1.2.3. Ablaufsteuerung.- 5.1.3. Agent.- 5.1.3.1. Umweltmodell und Erwartungsbildung.- 5.1.3.2. Strategie.- 5.1.3.2.1. Polypolistisches Automatisierungskonzept.- 5.1.3.2.2. Präferenzoffenbarung.- 5.1.3.2.3. Myopische Alternativstrategien.- 5.1.3.3. Sequenz der Transaktionsbedürfnisse.- 5.1.3.4. Interaktionssteuerung.- 5.2. Kernsystem memba.- 5.2.1. Realisierungsaspekte.- 5.2.2. Benutzungsschnittstellen.- 5.2.2.1. Marktplatz.- 5.2.2.2. Agent.- 5.3. Web-basierter Demonstrationsprototyp.- 6. Fallstudien zu Ausgewählten Marktszenarien.- 6.1. Polypol.- 6.1.1. Gleichgewichtsprozess.- 6.1.1.1. Startzeitpunkt.- 6.1.1.2. Erwartungshorizont.- 6.1.1.3. Auktionsfrequenz.- 6.1.2. Individualverhalten.- 6.1.2.1. Exemplarische Strategieberechnung.- 6.1.2.2. Variation des Transaktionsbedürfnisses.- 6.1.2.3. Myopische Alternativstrategien.- 6.1.3. Marktverhalten.- 6.1.3.1. Bewertungsvariation.- 6.1.3.2. Mengenvariation.- 6.1.3.3. Angebots- und Nachfrageüberhang.- 6.1.4. Kontraktdifferenzierung.- 6.1.4.1. Blindtest.- 6.1.4.2. Individuelle Strukturverzerrung.- 6.1.4.3. Effizienz.- 6.1.4.4. Kompensationseffekte.- 6.2. Andere Marktformen.- 6.2.1. Monopol.- 6.2.1.1. Klassisches Monopolszenario.- 6.2.1.2. Differenzierte Kontrakte.- 6.2.2. Dyopol.- 6.2.2.1. Bertrand-Preiswettbewerb.- 6.2.2.2. Hotelling-Szenario.- 7. Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.